Für alle, die vielleicht noch vor einer Biopsie stehen und sich unsicher oder ängstlich fühlen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Die Ärzte wissen genau, was sie tun, und obwohl es nicht angenehm ist, ist es auf jeden Fall auszuhalten.

Der Weg zur sicheren Diagnose
Die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung der Prostata steigt mit zunehmendem Alter. Eine Vorsorgeuntersuchung wird ab dem 45. Lebensjahr empfohlen. Je früher der Tumor entdeckt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Wächst der Tumor innerhalb der Prostata (organbegrenzt), liegen die Heilungschancen bei einer geeigneten Therapie bei deutlich mehr als 95 %. Doch nur wenige Männer der gefährdeten Altersgruppe nutzen die jährliche Krebsvorsorge. Und trotz intensiver Forschung gibt es für die Entdeckung eines Prostatakarzinoms noch keinen eindeutigen Marker.
Die Vorsorgeuntersuchung
Zur Prostatakrebsvorsorge wird heute vor allem ein Bluttest eingesetzt: die Bestimmung des PSA-Wertes (Prostata-spezifisches Antigen). Dieser Test kann Männern ab 45 Jahren nach einem Gespräch mit dem Arzt angeboten werden. Ein erhöhter PSA-Wert bedeutet nicht automatisch Krebs, sondern kann auch durch eine gutartige Vergrößerung oder eine Entzündung der Prostata verursacht sein.
Die klassische Tastuntersuchung oder ein Ultraschall durch den Enddarm entdecken frühe Tumoren nur selten und werden daher nicht mehr als eigentliche Vorsorgeuntersuchungen empfohlen. Sie können jedoch weiterhin im Rahmen der allgemeinen Krebsfrüherkennungsuntersuchung angeboten werden.
Zeigt der PSA-Wert Auffälligkeiten, wird in der Regel zunächst ein multiparametrische Magnetresonanztomographie (MRT) der Prostata empfohlen. Findet sich dabei ein verdächtiger Befund, entnimmt der Arzt gezielt Gewebeproben (Biopsie). Nur die feingewebliche Untersuchung dieser Proben kann weiter abschätzen, ob möglicherweise ein Prostatakarzinom vorliegt.
Eine Biopsie ist der nächste Diagnoseschritt
Bei dem Verdacht auf Vorliegen eines Prostatakarzinoms (erhöhter PSA-Wert und/oder Tastbefund der Prostata) wird in der Regel eine Gewebeprobe aus der Prostata entnommen. Dies kann aufgrund der Lage der Prostata über unterschiedliche anatomische Zugangswege erfolgen.
Transrektale Prostatabiopsie
Eine Prostatabiopsie über den Enddarm (TRUS-Biopsie) wird aufgrund des höheren Infektionsrisikos bei uns in der Klinik nicht mehr durchgeführt.
Perineale Prostatabiopsie
Hierbei erfolgt die Biopsieentnahme über den Damm unter lokaler Betäubung. Das Infektionsrisiko ist bei der perinealen Biopsie verringert, da die Darmschleimhaut hierbei nicht perforiert wird, es besteht daher ein nur geringes Risiko der Verschleppung von Darmbakterien in die Prostata.
Fusionsbiopsie
Die aktuellen deutschen Leitlinien empfehlen nach einer rein ultraschallgestützten Biopsie, die keinen Tumornachweis ergab, bei noch aber weiter auffälligem PSA-Wert ebenfalls vor einer erneuten Biopsie eine MRT der Prostata. Dieses Vorgehen hilft auffällige Gebiete in der Prostata aufzuzeigen und bei vermuteten Tumorgewebe an diesen Stellen der Prostata gezielt Proben zu entnehmen.
Basierend auf den europäischen Leitlinien und dem diagnostischen Mehrwert der Prostata-MRT erfolgt diese mittlerweile häufig bereits schon vor der ersten Biopsie. Die MRT ermöglicht durch die Visualisierung auffälliger Areale eine höhere Detektionsrate und Risikoabschätzung.
Diagnostik Sprechstunde
Montag bis Donnerstag von 8 bis 15:30 Uhr, freitags bis 14:30 Uhr
+49 (0)40 7410-28672
+49 (0)40 7410-40245
mk-diagnostik@uke.de
Peter H., 10.12.2024
Es ist Krebs! Wie geht es weiter?
Wird tatsächlich Prostatakrebs diagnostiziert, gibt es weitere Untersuchungen, um die Aggressivität und Ausbreitung des Tumors einzuschätzen. Diese Informationen sind unerlässlich, um für Sie die bestmöglichen Therapieoptionen zu identifizieren. Bei einem langsam wachsenden Tumor, der noch nicht metastasiert hat, könnte zum Beispiel auch die Aktive Überwachung eine geeignete Therapie sein.
Zunächst einmal liefert die Gewebeprobe den sogenannten Gleason-Score und die TMN-Klassifizierung.
Bei einem hohen Risikoprofil ist gegebenenfalls eine Ausbreitungsdiagnostik angeraten. Hier können verschiedene bildgebende Verfahren zum Einsatz kommen. Die Knochenszintigraphie untersucht, ob ggf. auffällige Herde im Bereich des Skelettsystems zur Darstellung kommen. Schnittbildverfahren wie die Computertomographie (CT) oder die Magnetresonanztomographie (MRT) können Auskunft über Auffälligkeiten in den Weichteilen wie zum Beispiel der Beckenlymphknoten oder anderen Organen geben. Gegenüber der klassischen Bildgebung hat sich die PSMA PET als überlegen erwiesen (Hofman et al., Lancet 2020). Diese kostenintensive Diagnostik wird allerdings oftmals (noch) nicht von den Krankenkassen übernommen.
Wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, besprechen Arzt und Patient gemeinsam die geeigneten Therapieoptionen.
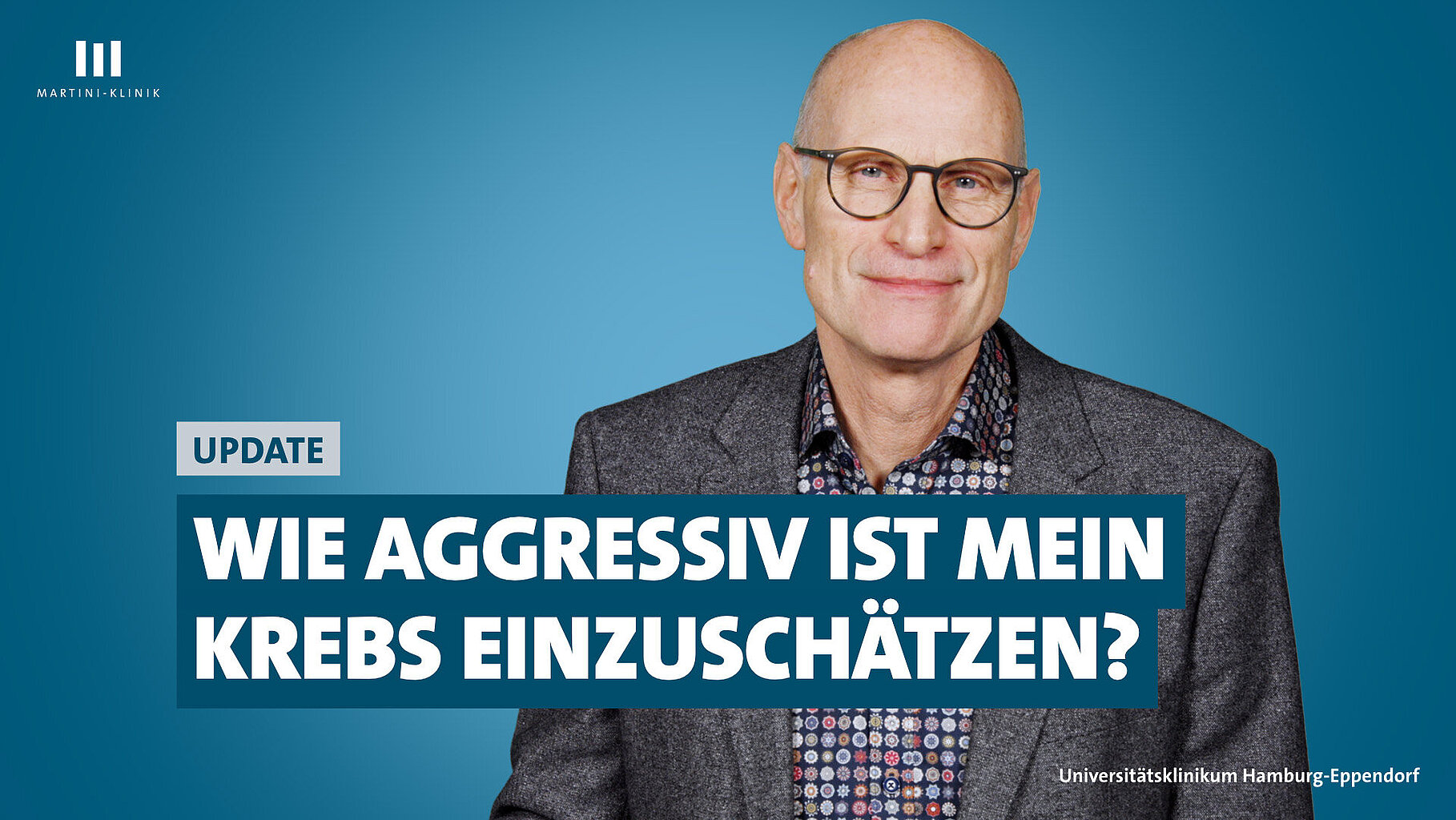
“Arztbrief leichter verstehen”
Prof. Dr. Hans Heinzer erklärt die verschiedenen Parameter, die der Therapieabwägung dienen.
9.01 Minuten
Neben der Tastuntersuchung, einem transrektalen Ultraschall (TRUS) sollte zusätzlich der PSA-Wert bestimmt werden.
Bei auffälligen Befunden und dem Verdacht auf Prostatakrebs sollte weitere Diagnostik in Form einer Biopsie erfolgen. Dabei gibt es verschiedene Biopsie-Arten.
Transrektale oder transperineale Prostatabiopsie
Bei der transrektale oder transperineale Prostatabiopsie werden mit einer speziellen Hohlnadel kleine Gewebeproben aus der Prostata entnommen und auf Krebszellen untersucht.
Fusionsbiopsie
Bei einer Fusionsbiopsie wird vor der Biopsie ein MRT gemacht. Dies zeigt bereits auffällige Areale der Prostata an. Bei der Fusionsbiopsie wird das MRT-Bild mit dem Ultraschallbild während der Biopsie fusioniert, sodass die Detektionsrate erhöht ist.
